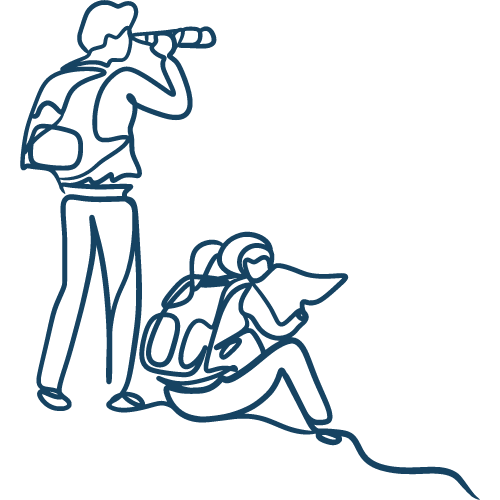Hallo ihr Lieben,
heute ist Sonntag, der 18.08.2024, und wir möchten euch heute von einem ganz besonderen Erlebnis berichten und zwar von unserer Begegnung mit den Himba. Was zunächst wie die neue Himbeer-Sorte von Maoam klingen mag, ist stattdessen das letzte halb-nomadische Hirtenvolk Namibias – wir haben uns also mit echten Ureinwohnern getroffen! Dazu sind wir nach Opuwo in den Norden des Landes gefahren: dort im Kaokoland leben sie nämlich. Man geht davon aus, dass die Himba ursprünglich im 16. Jahrhundert aus Angola oder Botswana nach Namibia kamen - da ist sich die Wissenschaft nicht so ganz einig. Mit weniger als 20.000 Menschen machen sie als ethnische Minderheit jedenfalls weniger als 1% der Bevölkerung des Landes aus. An die 50 Clans soll es (noch) geben, die mit ihren Ziegen- und Rinderherden von einem Weidegrund zum nächsten ziehen und dabei Strecken von 300 Kilometern und mehr zurücklegen.
Unser Besuch bei den Himba: Organisation mit Umwegen
„Einfach planbar“ war der Besuch jedoch nicht. Bei unseren Recherchen stellten wir nämlich fest, dass es - neben den echten und ursprünglichen Dörfern - auch extra für Touristen hochgezogene Wohngemeinschaften gibt, die täglich mit Busladungen voller Menschen nur für das eine Foto überrannt werden. Wir stießen dabei konkret auf das Ovahimba Living Museum, auf dessen Internetseite steht, dass „ein lebendes Museum eine authentische Darstellungsform von traditioneller Kultur ist. Es ist gleichzeitig eine Schule für Kultur und ein kommunales Unternehmen. Reisende in Namibia, aber auch Schulklassen und Menschen aus der eigenen Kultur können die Lebenden Museen besuchen und so zum Erhalt der Kultur und zur Armutsbekämpfung in Namibia aktiv beitragen.“ Theoretisch klingt die Beschreibung gut, aber praktisch waren wir beim weiteren Lesen doch eher abgeneigt: Bei den „Dorfbewohnern“ handelt es sich um Schauspieler, die traditionelle Aktivitäten extra für Besuchende in dem rein für touristische Zwecke erbauten Dorf vorführen. So kann man ihnen - zu fest definierten Zeiten – z.B. beim Kochen oder Tanzen zusehen. Selbstredend, dass die Himba nicht immer kochen oder wahllos tanzen – aber für die Touristen wird es eben aufgeführt. Bis hierhin mag das Ganze noch einen gewissen Charme haben, aber für unangebracht halten wir jedoch Aktivitäten wie „sich wie ein Himba anmalen und verkleiden zu lassen“ oder gar „wie ein Himba zu heiraten“. Das hat unserer Meinung nach nichts mit dem Verständnis der Kultur zu tun, sondern grenzt an kulturelle Anmaßung. Wir verstehen nicht so richtig, weshalb man in solch ein Fake-Dorf geht, wenn man doch schon einen so weiten Weg auf sich genommen hat und „so nah dran ist“. Vielleicht haben manche Gäste Angst vor der richtigen Begegnung, vor Verständigungsproblemen, haben Berührungsängste oder wollen nicht in die Privatsphäre der Ureinwohner eindringen. In Ordnung, aber dann kann man sich einen unechten Besuch doch auch irgendwie sparen… oder? Wir freuen uns (wie immer) über eure Meinungen dazu 😁
Wir jedenfalls wollten fernab von Touristenmassen ein echtes Dorf besuchen. Unsere Idee war es, die Dorfbewohner und ihre Lebensweise kennenzulernen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Uns zu unterhalten. Fragen zu stellen und eventuell auch welche zu beantworten. Denn auch solche Erfahrungsberichte hatten wir im Vorfel gelesen – und das entsprach mehr unserer Vorstellung. Klar war, dass wir einen Guide benötigen: am besten einen, der selbst dem Stamm angehört und sowohl Englisch als auch Himba spricht. Im Internet hatten wir nicht allzu viel Glück bei der Suche nach einer solchen Person. Und so entschieden wir einfach, auf gut Glück nach Opuwo zu fahren und vor Ort hoffentlich fündig zu werden. Uns war jedoch klar: Wenn wir nichts Authentisches finden, lassen wir es sein. Wir fuhren also von Swakopmund über Kamanjab nach Opuwo – insgesamt süße 680 Kilometer über holprige Sandpisten. Opuwo bedeutet in der Stammessprache der Himba übrigens „Das Ende“ – ein ganz passender Begriff für den staubigen 12.000 Seelen-Ort. Es gibt drei Tankstellen, drei Supermärkte, ein paar Kneipen und eine Lodge für Touristen. Das war's. Ende eben. Doch immerhin merkten wir auf der Durchfahrt, dass wir vermutlich richtig sind, denn wir sahen bereits vermehrt Himba-Frauen, die traditionell barbusig sind und rote Lehmhaare tragen. Zwar hatten wir sie fairerweise nicht in einer „modernen“ Stadt erwartet, aber das war nicht das erste Mal, dass unsere Vorstellung und die Realität voneinander abwichen.
Angekommen in unserer Unterkunft fragten wir jedenfalls direkt, ob sie uns einen entsprechenden Guide empfehlen können. Zu unserem Entzücken lautete die Antwort: „YES!“ Anders als in den anderen Regionen Namibias gestaltete sich die Verständigung mit dem Personal jedoch als recht schwierig. Wir waren uns also nicht ganz sicher, ob wir verdeutlichen konnten, dass wir einen authentischen Dorfbesuch wollen und keinen Schauspiel-Hokuspokus. Nachdem wir dann (ungelogen) über zwei Tage hinweg 5 Mal nachgefragt hatten, ob und wann die Tour nun stattfinden würde, hatten wir dann 2 Stunden vor Beginn endlich Zeit- und Treffpunkt. Je näher das Treffen rückte, desto aufgeregter wurde Patty: seit sie in Kindertagen ein Foto von ihrer Tante und ihren Cousinen gesehen hatte, die neben indigenen Menschen vor Lehmhütten saßen, wollte Patty auch solch eine Erfahrung machen. Und bald sollte dieser Kindertraum also in Erfüllung gehen.
Wie wir im Himba-Dorf fast 4 Kinder adoptiert haben
Endlich war es dann nachmittags so weit: Wir trafen uns mit unserem Guide namens Comma vor dem Supermarkt in Opuwo. Es stellte sich heraus, dass der sympathische Mann 34 Jahre alt ist, hervorragend Englisch spricht und selbst aus einem Himba-Dorf stammt, sich jedoch gegen das traditionelle Leben und für die Arbeit im Tourismus entschieden hatte. Als wir dann noch versichert bekamen, dass wir ein echtes Dorf besichtigen würden – irgendwo außerhalb der touristischen Pfade – waren wir massiv erleichtert und freuten uns noch mehr. Durch unsere Recherchen wussten wir bereits, weshalb wir uns am Supermarkt getroffen hatten: ohne Lebensmittel dabei zu haben, ist die Chance, in ein Himba Dorf gelassen zu werden, nämlich sehr gering. Sie wollen kein Geld, sondern Essen als „Eintrittsgeld“ in ihre Welt. Wir schnappten uns also einen Einkaufswagen und besorgten Maismehl, Zucker, Öl, Butter, Brot, Nüsse für die Kinder und Tabak für den Stammesführer – insgesamt hatten wir schlussendlich Gastgeschenke im Wert von ca. 35 Euro dabei und zahlten zusätzlich knapp 18 Euro für den Guide.
Anschließend fuhren wir mit unserem Auto los – aus der kleinen Stadt raus und immer weiter über Schotterpisten. Um uns herum nichts. Keine Shops, keine Dörfer. Einfach nur Natur. Patty konnte natürlich nicht anders und stellte schon auf der Autofahrt 239 Fragen während Pierre uns über immer enger werdende, kleine Wege landeinwärts fuhr. Nach ungefähr einer halben Stunde kamen wir dann an – im gefühlten Nichts. Vor uns standen nur ein paar runde Lehmhütten, die durch einen Zaun aus großen, abgebrochenen Ästen geschützt waren. Comma stieg aus und bat uns, im Auto zu warten, während er den Stammesführer fragen geht, ob wir zu Besuch kommen dürfen. Hier gibt es neben Strom und fließend Wasser nämlich auch kein Telefon, über das man sich vorher hätte ankündigen können. Wir warteten und schauten uns um: wir standen inmitten von felsigen Gebirgen und dürrer Vegetation. Hier leben die Himba seit mehr als 500 Jahren und haben über die Jahrhunderte zäh allerlei Gefahren und Einflüssen getrotzt: Dürren, Missionare, räuberische Völker, deutsche Kolonialherren und und und. Dass Menschen in dieser trockenen, sandigen, einfachen Welt leben können, beeindruckte uns. Wir hingegen ließen die Klimaanlage laufen, denn es herrschten flauschige 34 Grad. Aus der Distanz sahen wir bereits die ersten Kinder aufgeregt durch’s Dorf laufen. Nach einigen Minuten kam Comma fröhlich wieder und teilte uns mit, dass wir herzlich willkommen seien. Hätte uns der Stammesführer abgewiesen (z.B. wegen einer gerade stattfindenden Beerdigung), wären wir übrigens in das nächste Dorf gefahren.
Zum Glück war das nicht nötig und so brachte uns Comma noch schnell bei, wie wir uns richtig auf Himba vorstellen: mit einem Handschlag sowie den Worten „Morrow Morrow. Perewi? Pere naua! (Hallo. Wie geht es dir? Danke, mir geht es gut!) Wir taten uns mit den fremden Worten schwer, aber gaben uns alle Mühe, die wir dabei hatten. Als wir uns langsam dem Dorfkern näherten, fiel uns auf, dass gleich zwei Welten aufeinander treffen werden, die (zumindest äußerlich) unterschiedlicher nicht sein konnten: wir in T-Shirt und Hose – vor uns die nur mit etwas Leder um die Hüften bedeckten Himba mit ihren nackten Kindern auf dem Schoß. Wir mit Rucksack und Kamera, die Himba mit ihren auffälligen Haaren, dem selbstgemachten Schmuck und der handgefertigten Kleidung. Wie es wohl werden würde?
Zunächst trafen wir (natürlich) auf das Oberhaupt, den "Ondangwa": der hagere, alte Mann saß auf einem Stuhl im Schatten und schien erfreut über unseren Besuch. Neben ihm saßen 3 Frauen mit 8 kleinen Kindern auf dem Boden und knüpften Schmuck – auch sie lachten uns freundlich an. Die Sonne brennt, es ist trocken und staubig, überall schwirren Fliegen umher. Wir stellen uns vor und bedanken uns, dass wir dort sein dürfen. Viel mehr fiel uns (trotz der Vorbereitung) vor lauter Aufregung im ersten Moment nicht ein. Joa, und was macht man dann am besten in so einer abgefahrenen Situation? Patty kaschierte ihre Aufregung, indem sie einfach mit den Kindern spielte, die (wie immer) am wenigsten Berührungsängste hatten. Dann fiel ihr wieder ein, dass die Himba als offen, freundlich und gesellig gelten und so suchte sie einfach Augenkontakt zu den Frauen und fragte, was sie dort für Schmuck herstellen. Comma übersetzte fleißig, schnell und gut, wodurch beide Seiten schnell auftauten. Auch die Frauen zeigten sich interessiert und machten Witze darüber, dass wir noch nicht verheiratet seien. Mit ernster Miene rief uns irgendwann der Stammesführer zu sich: er wies Pierre mahnend darauf hin, dass er Patty schnell heiraten müsse, da wir sonst zwei Jungen und zwei Mädchen aus dem Dorf mitnehmen müssen… und brach dann in Gelächter aus, in welches wir einstimmten. Wir merkten also recht schnell, dass wir – trotz der äußerlichen Unterschiede - eine Gemeinsamkeit zu haben scheinen: den Humor.
Anschließend führte uns Comma durch das Dorf, in dessen Mitte sich der Kraal, also das Gehege für das Vieh, befindet. Die Hütten der einzelnen Familien sind kreisförmig darum verteilt. Alle Ausgänge blicken in Richtung des Kraals, damit die Menschen immer ihren wertvollsten Besitz im Auge haben: ihr Vieh. Die Rundhütten sind aus Ästen, Sand und Kuhdung gefertigt, während das Dach aus Stroh besteht.
Zwischen der Hütte des Oberhauptes und dem Kraal ist ein großer Holzhaufen: das heilige Feuer. Der "Okuruwo" spielt eine zentrale Rolle im spirituellen Leben des Volkes. Es dient als Verbindung zu den Vorfahren und muss kontinuierlich brennen, da es als Schutz für die Familie gilt. Außerdem finden hier alle traditionellen Zeremonien statt wie zum Beispiel Hochzeiten oder auch folgender Brauch: Im Alter von 10 bis 12 Jahren werden den Kindern traditionell die unteren vier Schneidezähne mit einem Stein und einem Stück Holz ausgeschlagen – dies gilt hier als Schönheitsideal. Wir fragen Comma, weshalb er noch alle Zähne habe, da er ja ebenfalls in einem Himba-Dorf aufgewachsen sei. Er erklärt, dass die wenigen Kinder, die zur Schule gehen, von der „Schönheits-OP“ verschont bleiben. Ebenso fiel uns auf, dass einige Kinder westliche Mode statt Leder tragen: ebenfalls ein Zeichen dafür, dass es sich um Schulkinder handelt.
Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Wir spazieren weiter durch das staubige Dorf, in dem gerade weitere Bewohnende ankommen. Comma fragte uns indessen erstaunt, ob wir keine Fotos machen wollen und Patty erklärte ihm, dass wir erstmal mit den Menschen Kontakt aufnehmen wollten, bevor wir sie zu Fotoobjekten machen. Unser Guide freute sich über diesen Ansatz und versicherte uns trotzdem, dass wir ungehemmt Fotos machen können. Patty holte also die Kamera aus dem Rucksack und fing (weiterhin verhalten) an, die Eindrücke fotographisch festzuhalten. Vor einer Art Hütte auf Stelzen bleibt Comma stehen und erklärt, dass es sich um Vorratskammern handelt, in denen Maiskörner gelagert werden. Dazu werden die geernteten Maiskolben getrocknet und anschließend unter körperlicher Anstrengung mit langen Stöcken in einer Tonne bearbeitet, um den Mais vom Kolben zu trennen. Diese Aufgabe übernehmen die Frauen und Jugendlichen des Dorfes. Die getrockneten Körner werden dann mit Steinen gemahlen, um Maisbrei zu machen. Anschließend zeigt er auf eine Holz-Box im Baum, in der Fett und Fleisch aufbewahrt werden. Oh Wunder, die Himba besitzen nämlich keinen Kühlschrank, und so schneiden sie das Fleisch in Streifen, trocknen es und lagern es im Schatten des Baumes – weit oben, damit keine ungebetenen Tiere dran kommen.
Uns fällt währenddessen auf, dass wir – abgesehen vom Stammesführer - ausschließlich auf Frauen und Kinder treffen. Comma erklärt, dass die Männer mit dem Vieh auf der Suche nach Nahrung unterwegs sind, da das semi-nomadische Leben stark von den Jahreszeiten und der Verfügbarkeit von Wasser und Weideflächen geprägt ist. Und so ziehen die Männer (und wenige Frauen) von einem Ort zum anderen und bauen sich dort wieder ihr eigenes, kleines Dorf (Onganda) auf. Es gibt allerdings ein Hauptdorf, zu dem sie immer wieder für ein paar Monate im Jahr zurückkommen. Uns wird klar: wir befinden uns in dem Hauptdorf des Clans.
Wir kommen zu Mcheto und Nguaundjajo, die vor einer der Lehmhütten im Sand sitzen. Nguaundjajo wickelt ihren Lendenschurz ab, bietet Patty einen Sitzplatz neben sich an und deutet auf die Kamera. Comma übersetzt, dass sie sich ein Foto mit Patty wünscht und Pierre knipst fröhlich drauf los. Anschließend zeigen wir ihr die Fotos und sie scheint sichtlich erfreut. Da wir uns bei den beiden Frauen wohl fühlen, beginnen wir erneut ein (durch Comma übersetztes) Gespräch: Sie erzählen uns stolz, dass man die Himba an ihrer traditionellen Kleidung erkennt. Sie tragen Schürzen aus Kuh- oder Ziegenleder und Fell. Das für unsere „europäischen Augen“ Ungewöhnlichste war vermutlich weiterhin, dass die Himba-Frauen obenrum keine Kleidung tragen – die weibliche Brust ist hier immer unbedeckt, dafür aber üppig mit traditionellem Schmuck aus Leder, Holz und Muscheln behangen. Der dient nicht nur zur Zierde, sondern hat auch symbolische Bedeutung – ebenso wie die Messingringe an den Hand- und Fußgelenken, die etwas ungemütlich aussahen. Der Schmuck zeigt z.B. ob die Frauen verheiratet sind oder wie viele Kinder sie bereits haben.
Auch Mcheto möchte nun ein Foto mit Patty und winkt sie zu sich. Besonders gefreut hat uns, dass die Himba mindestens genauso interessiert an uns waren, wie wir an ihnen. Wir werden gefragt, ob auch wir draußen kochen und wir versuchen, ihnen unser Grillen im Sommer zu erklären. Mcheto scheint jedoch kaum hinzuhören, da sie staunend mit ihren Fingern durch Patty’s Haare fährt: sie seien so weich und leicht. Bei einem Blick auf Patty’s Unterarm ist sie zudem überrascht und rubbelt erstaunt über ihre sichtbaren Adern – so etwas habe sie noch nie gesehen. Ab diesem Moment verlor Patty ebenfalls die Hemmung, den Schmuck und die kunstvollen Haare der Himba-Dame anzufassen. Also… natürlich nach vorher erteilter Erlaubnis, versteht sich – haha.
Um ihnen noch mehr Dinge zu zeigen, die ihnen vielleicht neu sind, zeigte Patty daraufhin auf Pierre’s Bein. Sie schrubbte über die Tattoos und sagte: "Guckt mal, die Farbe geht nicht mehr ab." Die beiden Himba-Ladies waren begeistert von den bunten Bildern und sagten, dass sie auch welche wollen. Doch dann stellten sie in demselben Atemzug fest, dass ihre Haut zu schwarz sei und man gar nichts erkennen würde – wieder lachten wir alle miteinander. Ist das nicht verrückt, dass unsere Leben so gänzlich anders verlaufen und dass uns doch derselbe Humor verbindet? Kurz darauf stolperten wir aber auch über einen spannenden Unterschied und zwar als wir die beiden nach ihrem Alter fragten. Himba zählen ihre Jahre nämlich nicht, sondern denken in prägnanten Momenten wie z.B. „als ich geboren wurde, gab es den großen Baum noch nicht“ oder „als ich jung war, hat das Stammesoberhaupt geheiratet“. Mangels (Schul)bildung zählen die Menschen hier generell nicht. Wir fragen, wie sie dann die Vollständigkeit ihres Viehs prüfen, bekommen aber eine logische Antwort: „Wenn die Kuh mit dem weißen Kopf fehlt, wissen wir, dass etwas nicht stimmt.“ Na gut, hätten wir auch selbst drauf kommen können.
Als zwei Jugendliche zu unserem Sitzkreis dazustoßen, erklärt uns Comma, dass es auch bei der Haartracht der Himba nicht nur um Schönheit, sondern um Tradition und sozialen Status geht. An den eng geflochtenen Zöpfen der Kinder erkennt man das Alter und das Geschlecht. Bei Kleinkindern sind die Haare noch so kurz, dass man ihnen Streifen rasiert. Sobald die Haare lang genug sind, werden daraus zwei Zöpfe geflochten: Die Mädchen tragen die Zöpfe nach vorne, die Jungen nach hinten. Mädchen, die ihre Periode bekommen haben, kriegen ihren ersten Kopfschmuck sowie die Lehmhaare. Außerdem wurde uns erklärt, dass Himba heutzutage Kunsthaare dazukaufen, um den puscheligen Abschluss hinzubekommen. Die Haarpracht muss, je nach Beschaffenheit der Haare, alle zwei bis vier Monate komplett erneuert werden.
Ein Blick in die Hütte des Oberhauptes und seiner ersten Frau
Wir hätten uns gern noch ewig mit den Damen unterhalten, aber unser Guide hatte noch ein weiteres Highlight für uns: Wir durften die Hütte des Oberhauptes betreten, in der er mit seiner ersten Frau und den gemeinsamen Kindern schläft. An der Formulierung merkt ihr Füchse wahrscheinlich schon, worauf wir hinaus wollen: riiichtig, die Himba leben polygam. Die erste Frau wird vom Vater ausgesucht, die weitere(n) Frau(en) darf sich der Mann selber aussuchen. Die Mädchen, die vom Vater ausgesucht werden, werden im Alter von nur ein paar Jahren versprochen. Sie wachsen dann in der Familie des zukünftigen Mannes auf, der in der Regel deutlich älter ist. Mit dem Erreichen der Geschlechtsreife wird dann das Eheleben begonnen. Männer tendieren zu mehreren Ehefrauen, insbesondere, wenn diese viel Vieh besitzen, da der Besitz der Tiere von der Mutter an die Tochter weitergegeben wird. Zurück zur Unterkunft: Innen ist es ziemlich dunkel, es gibt keine Fenster, nur eine kleine Feuerstelle. An den Wänden hingen Lederröcke, Kopfverzierungen, Ketten und Felle. In den Hütten schlafen die Menschen auf Tierhäuten. Comma zeigt uns das „Kissen“ des Mannes: Ein kantiger Holzblock, um zu vermeiden, bei all den lauernden Gefahren in einen tiefen Schlaf zu fallen.
Erfreulicherweise waren wir in der Hütte nicht allein, denn Uaituambo, die erste Frau des Stammesführers, saß ebenfalls auf dem Boden ihres Zuhauses. Sie fummelte einen walnussgroßen Roteisenstein aus einer Plastiktüte. Zwischen ihren angewinkelten Beinen zermahlt sie den Ocker-Stein zu feinem Pulver, welches sie anschließend auf ihrer Handfläche mit Butterfett aus Ziegenmilch vermischt. Diese ockerfarbene Paste, die "Otjize", schmiert sie sich anschließend von Kopf bis Fuß auf die Haut und in die Haare. Dieses rote Gemisch schützt sie vor der intensiven Sonne, vor Mücken und verleiht ihrer Haut den charakteristischen, rotbraunen Glanz, der nicht nur ästhetisch, sondern auch symbolisch für die Verbundenheit mit dem Land steht. Der Geruch erinnert uns an einen Wachsmalstift oder eine Kerze – total angenehm. Vor allem diesbezüglich waren wir gespannt, denn ab dem Zeitpunkt, an dem sie ihre Periode bekommen, waschen sich Himba-Frauen nicht mehr mit Wasser. Neben dem Tragen der Otjize nehmen sie täglich ein Rauchbad, um ihre Hygiene aufrechtzuerhalten. Sie legen glimmende Holzkohle in eine kleine Schale mit Kräutern, beugen sich über diese und warten, bis der Rauch aufsteigt. Die Paste - gepaart mit dem Kräuter-Parfüm - ist also ihre „Dusche“. Wieso? Nun ja, die Menschen leben in einer der trockensten Regionen der Erde, sodass die Unzuverlässigkeit, überhaupt Wasser zu finden, zu diesem Ritual geführt hat. Männer hingegen dürfen sich ihr ganzes Leben lang mit Wasser waschen – aber eben auch nur dann, wenn sie welches auf ihren „Streifzügen“ finden. Auch wenn wir geruchstechnisch keinen Mangel an Hygiene feststellen konnten, können wir uns fairerweise diesen Körperkult nur schwer vorstellen – vor allem im Intimbereich. Aber hey, wir müssen schließlich nicht alles austesten, was wir so erleben.
Es ist vorbei - bye bye
Während wir in der Hütte waren, hatten alle Damen des Dorfes selbst geschnitzte Souvenirs und handgemachten Schmuck für uns auf ihrem „Marktplatz“ im Kreis aufgebaut. Es brach uns fast das Herz, dass wir aufgrund des Platzmangels in unseren Rucksäcken (denkt an all die Tiere!) dankend ablehnen mussten. Alle versicherten uns jedoch, dass das absolut in Ordnung sei und wir einfach all unseren Freunden Bescheid sagen sollen, dass sie vorbeikommen sollen. Das machen wir hiermit! Und nach knapp 2 ½ Stunden neigte sich unsere Begegnung dann auch schon wieder dem Ende zu. Wir wurden von hüpfenden Kindern und einigen Frauen zu unserem Auto begleitet, die uns glücklich unsere Mitbringsel abnahmen und dann wieder ins Dorf verschwanden. Wir schauten ihnen noch eine Weile hinterher. Für uns sind die Himba ein lebendiges Beispiel für den Erhalt alter Traditionen in einer sich schnell verändernden Welt. Ihre Kultur und ihr unerschütterlicher Glaube an die Bedeutung der Gemeinschaft und der Ahnen machen sie zu einem der faszinierendsten Völker Afrikas.
Obwohl wir so fremd waren, fühlten wir uns so nah und merkten, dass wir im Grunde gar nicht so unterschiedlich sind.
Und damit sagen wir danke – äh Okuhepa - liebe Himba, für diesen unglaublich bereichernden Besuch!
Du möchtest mehr erfahren? Hier geht's zu weiteren Beiträgen: